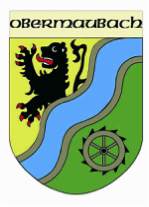Das Stadtgebiet von Nideggen
Stadtverfassung: Es ist unzweifelhaft, daß zuerst an das Grafenschloß zu Nideggen auf der Höhe des Bergrückens ein Burgflecken sich anbaute und mit festen Mauern, Türmen und Toren versehen wurde. Da der beschränkte Raum jedoch bald für die vermehrte Bevölkerung nicht ausreichte, so wurden neue Mauern in weiterem Umkreis gezogen und dieser neue Stadtteil erhielt die Hauptbedeutung, so daß der alte kleine Burgflecken in der Folge alle Bewohner verlor und nur noch die Kirche nebst der Pfarrwohnung enthielt. Wahrscheinlich hat Graf Gerhard diese Erweiterung vorgenommen, und als sie vollendet war, der neuen Stadt das große Privileg von 1313 verliehen, welches die Grundlage oder wenigstens die Bestätigung der städtischen Freiheiten enthält. Durch dasselbe wurden der Stadt zwei Rechte zugesichert: das Recht der Freiheit von Steuern, Zöllen, Abgaben jeder Art im ganzen Lande für die Eingesessenen von Nideggen belangt zu werden. Durch diese beiden Rechte war der Ort ganz außerhalb des Amtsverbandes gestellt, weil man von der Heranziehung zu den Amtssteuern, Fronfuhren, Hand- und Spanndiensten und so weiter befreit war.
Durch das große Privileg von 1313 war Nideggen auch mit eigener Gerichtsbarkeit versehen worden. Die neue Stadt erhielt außerhalb ihrer Mauern ein gewisses Gebiet, ebenfalls eine Schenkung der Grafen, deren Eigentum wohl ursprünglich die ganze Waldgegend der Rur entlang war. Dieses Stadtgebiet, zu dem die Vorstädte Altwerk (1361) und Pagen vor dem Dürener und Brandenberger Tor, die Häuser an der Rurbrücke auf der rechten Flußseite, verschiedene Mühlen in der sich von Nideggen nach Brück hinabziehenden Schlucht, die Höfe Schüdderfeld, Birfeld und Drischhof, sowie von den beiden 1605 auf der Laach befindlichen Häusern das oberhalb des Kallweges gehörte, während das unterhalb des Kallweges gelegene auf dem Grunde des zu dem Gute Hetzingen gehörigen Hofes Kallerbend lag. Dieses Stadtgebiet erstreckte sich also innerhalb der in einem Grenzbesichtigungsprotokoll von 1663 angegebenen Marken, die noch jetzt die Gemeinde Nideggen einschließen, wenn man von dem durch Einverleibung des Dorfes Rath und der Höfe Kallerbend, Laach und Neuenhof erlittenen Zuwachs absieht.
Außer diesem Stadtgebiet, dessen Bewohner mit den Einwohnern des Städtchens selbst die eigentliche und vollberechtigte Bürgerschaft bildeten, gab es ein davon vollständig abgetrenntes, eine Stunde unterhalb Nideggens gelegenes Territorium, das in ganz eigentümlichen Beziehungen zu letzterem stand. Dieses Territorium umfasste das Dorf Obermaubach, den Weiler Schlagstein und den bei Schlagstein gelegenen, jetzt nicht mehr existierenden Hof Ramsauel. "Overmoybach" kommt schon 1243 als ein zu Nideggen gehöriges Dorf vor, 1330 Slaystein, 1390 auch "alsulches guyt, as dat is gelegen zu Raemsauwel ind is burger guit zu nydeggen".
Obermaubach, Schlagstein und Ramsauel bildeten eine eigene Gemeinde, deren Vorsteher Statthalter genannt wurde. Die Mitglieder der Gemeinde nahmen teil an den Privilegien der Stadt, Steuerfreiheit und Gerichtsbarkeit des Stadtschultheißen, sie hatten die sogenannte auswärtige Bürgerschaft und hießen auch die Nachbarn von Obermaubach. Doch waren sie nur halbberechtigte Bürger, und ihr Verhältnis der römischen civitas sine suffragio et jure honorum vergleichbar. (In kirchlicher Hinsicht war im 16. Jahrhundert Obermaubach eine Kapelle und Filiale von Kreuzau sine cura. Die Einkünfte derselben bestanden in 900 Reichstaler jährlichen Kapitals, Interesse 45 Reichstaler, in einem Zehnten zu Merzenich, tat 8 Malter Roggen, 3 Malter Gerste, in einem noch kleinen Zehntchen zu Maubach, tat 12 Viertel Roggen, 12 Viertel Hafer, noch von 50 Reichtalern das Interesse, auch vom Hof zu Thum 10 Malter Speltz, auch von einem Viertel Land 5 Viertel Hafer, ferner 3 Mütgen Weingärten, davon aber 40 Quart Wein an Schwarzenbroich geben wird.) (Interesse = Zinsen)
Sie hatten nämlich an der Selbstverwaltung der Stadt keinen Anteil und standen dieser gegenüber in einer gewissen Abhängigkeit, weshalb sie auch vom Rat zu Nideggen die Untertanen von Obermaubach genannt werden. Der städtische Rat, in dem sie keine Vertretung hatten, dekretierte die Steuern, die sogenannte bürgerliche Umlage, von der 2/3 auf die Stadt, 1/3 auf Obermaubach fiel. Der Statthalter wurde in die betreffende Ratssitzung nur zur Kenntnisnahme eingeladen und besorgte dann selbst die Verteilung des auf seine Gemeinde fallenden Pauschquantums.
Der Rat forderte nach Bedürfnis die Nachbarn zu Wachdiensten in der Stadt, zu Fronfuhren, zu Hand- und Spanndiensten ein. Es wurde sorgfältig darauf gesehen, daß dieselben auch an sonstigen städtischen Lasten teilnahmen. So wurden ihnen mehrmals außerordentliche Steuern auferlegt, um die Stadt für Einquartierungen zu entschädigen, die nur sie, nicht aber die Nachbarn betroffen hatten. Der Statthalter wurde ursprünglich vom Rat aus vier durch die Gemeinde vorgeschlagenen Personen gewählt. Nachdem 1655 der Statthalter gestorben war, beschloss der Rat, keinen neuen mehr einzusetzen, sondern "nur dem Geschworenen einen Beigeschworenen zu adjungieren". Später wird der Vorsteher auch Bürgermeister genannt. 1761 bittet der Bürgermeister zu Obermaubach den Rat, ihn zu entlassen. Er schlägt eine ,die Gemeinde eine zweite Person vor, aus denen der Rat einen neuen Bürgermeister "nach altem Gebrauch wählte".
Zu Gericht standen die Nachbarn vor dem Schultheiß zu Nideggen, wo auch ihre Güter vererbt wurden. Zwar hatten sie auch einen eigenen Schultheiß und 2 Schöffen zu Obermaubach und 1 Schöffen in Schlagstein, allein ersterer ist auch Mitschöffe zu Nideggen, besitzt also kein selbständiges Gericht. Als Angehöriger desselben Gerichtes lesen die Nachbarn 1561 den 15. Januar gleich denen von Berg und der Nideggener Bürgerschaft auf dem Herrengeding in Nideggen ihre Weistümer ab (Weistuum = Aufzeichnung von Rechtsgewohnheiten und Rechtsbelehrungen). Später wurde auch zu Obermaubach selbst Herrengedinge gehalten beim Vorsteher, wobei man die churfürstlichen Verordnungen verlas.
Von verschiedenen Seiten wurde der Stadt ihre Oberherrlichkeit über die Nachbarn streitig gemacht. Peter von Ramsauel wollte die Gerichtsbarkeit des Stadtschultheißen nicht anerkennen und keine Beiträge zu den städtischen Lasten geben, indem er sich auf einen Mannlehenbrief von Herzog stützte, nach dem sein Hof gefeit sein sollte. Das Hauptgericht zu Jülich aber verurteilte ihn 1483, in Nideggen vererbt zu werden und an den städtischen Steuern mit zu bezahlen, weil nach Ausweis der Schatzzettel die von Ramsauel lange Jahre hindurch daran teilgenommen. Auch später, als Grundstücke von Ramsauel getrennt und an Leute von Winden, Kreuzau usw. gekommen waren, wurden diese zu den städtischen Steuern gezwungen.
Die heftigsten Anfeindungen ihrer Rechte aber erfuhr die Stadt von seiten der Herren von Vlatten, die zu Obermaubach einen Hof besaßen. Conrad, Jülicher Erbschenk, Herr zu Vlatten, Froitzheim und Eynatten, kommt 1529 zuerst als Eigentümer dieses Hofes vor, der nach ihm der Vlattener oder der Schenkenhof hieß. Dann ging derselbe an Conrads zweiten Sohn, Heinrich von Vlatten zu Vlatten und Eynatten über, dessen Sohn Wilhelm sich zuerst Freiherr von und zu Vlatten und Obermaubach nannte; letzterer Titel war nie angenommen und nicht ererbt, wie es auch früher niemals ein Adelsgeschlecht von Obermaubach gegeben hat. Es hatten vielmehr die Herren von Vlatten nach sich stets gleichbleibenden Aussagen der Zeugen, einige Erbgüter in Obermaubach käuflich erworben und solche an Leute aus dem Dorf in Erbpacht gegeben; es wurden Bücher über die Verleihung derselben, den Übergang auf die Erben, Verkauf und sonstige Übertragungen, geführt. Auf diese Weise war eine Anzahl von Leuten in den Hof haferpacht-, pfennigsgeld-, zehntpflichtig und churmütig geworden. (Der Kurmut war das auf der Grundherrlichkeit beruhende, also nur den Pächtern gegenüber vorkommende Recht, bei einem Erbfall das beste Stück des Nachlasses zu küren, d.h. sich zu wählen und vorweg zu nehmen. Im Kirchspiel von Kreuzau war jeder Hausstand, Mann und Frau, churpflichtig und das Beste quitt, so nach eines jeden Absterben auf dem Hof oder in dem Stalle befunden wurde, wenn der Mann starb, dem Fürsten die Auswahl zustand, wann die Frau vorher mit Tod abging, der Mann sich zuerst das beste Stück nahm im Beisein von Schultheiß und Schöffen. Sogar an den Hofesgütern, die auf der Burg zu Kreuzau churpflichtig waren, hatte der Fürst die Vorchur. Ebenso churpflichtig waren die Erbpachtländereien. Jeder Pächter empfing seine eigene Länderei für empfangende Hand; starb einer unter solcher empfangenden Hand, so nahm der Fürst das beste Stück aus Stall oder Hof.)
Nachdem dieses Verhältnis eine Zeitlang gedauert und die Herren diese Güter durch neue Ankäufe stets zu vermehren gesucht hatten, glaubten sie, etwas wagen zu dürfen. Sie verweigerten plötzlich nicht nur von ihren Grundstücken zu Obermaubach der Stadt Nideggen den Schatz (Abgaben), sondern behaupteten sogar, Grundherren des ganzen Dorfes zu sein, wofür sie eben jene sorgsam geführten Bücher als Beweis vorbrachten und wollten dessen Bewohner in die Lage von hörigen Bauern zurückdrängen, die alle ihre Güter, die doch ihr freies Eigentum waren, aus dem Hof als einen Land- und Lehenhof empfangen hätten; alle Dorfbewohner sollten ihre Güter auf dem Hof vererben und statt vor dem Gericht zu Nideggen, vor dem des jülichen Amts Wehrmeisterei, der sogenannten Wildbank zu Rechte stehen, indem Obermaubach mit Nideggen keine Gemeinschaft habe, sondern zum Pfälzischen Lehen und der Vlattener Erbförsterhof unter die Wildbank gehöre.
Gegen solche Anmaßung protestierten die Nachbarn energisch. Sie bekannten 1563 auf dem Vogtgeding, sie und ihre Vorfahren hätten stets zu Nideggen vor Gericht gestanden. 1579 bekennen sie, "daß sie nach Nideggen gehörten mit Schatz und Dienst, Glockenklang und anderen hoher Obrigkeit angehörigen Stücken, und bei einem Übergang der Hofgüter sei zwar die Überschreibung auf den Hof geschehen, doch nur damit der Herr wisse, von wem er Zins und Pacht einzufahren habe, daß aber alle Verschreibungen, Verpfändungen, Versatz oder rechtsstreitige Sachen von alters her in Nideggen abgemacht worden seien". 1601 erklären sie, daß der Verkauf von Hofesgütern beim Halfen im Beisein von 2 Hofesmännern angegeben und dem Halfen ein schlechter Weißpfennig und jedem Hofesmann ein schlechter Schilling a 6 Stüber gegeben würden, damit die Herrschaft wisse, von wem die Pacht bezahlt werde; doch sei die Vererbung immer in Nideggen geschehen. Auch seien selbst die churmütigen Güter, deren damals nur 6 vorhanden waren, stets zu Wachtdienst und Schatz gleich den anderen angehalten worden.
Da 1610 eine von "Coen von Vlatten und sämtliche Nachbarn des Dorfes Obermaubach" unterzeichnete Bittschrift an den Fürsten geschickt wurde, worin man klagte, daß die Stadt Nideggen bisher unbilligerweise die Obermaubacher zu Schatz, Wachten und Diensten gezwungen habe, während sie doch in den Hof gehörten, bekannten bei Untersuchungen der Sache zur Schmach des Herrn Coen sämtliche Obermaubacher, "daß sie die Bittschrift nicht kannten und nicht unterzeichnet hätten, sie gehörten zu Nideggen und wollten von dem Vlattener nichts wissen". Es ist also sonnenklar, daß die ganze Geschichte nur eine Spekulation der Herren von Vlatten war, sich ein Gut zu verschaffen, auf das sie nicht den geringsten Anspruch hatten. Stets wurde daher auch die Stadt von den Gerichten in ihren Rechten gehandhabt und nur von dem Burghaus, der zu demselben gehörigen Mühle und einem dritten Hause die Exemtion (Befreiung von einem Gesetz oder Recht) und Zugehörigkeit unter die Wildbank aufrecht erhalten.
Beanspruchten einerseits die Nachbarn die Vorteile der Stadtangehörigkeit, so sträubten sie sich andererseits doch häufig gegen die Lasten, was sich allerdings aus der außerordentlichen Steigerung derselben zufolge der fortwährenden Kriege leicht erklärt. Doch wurden sie durch Urteile des Düsseldorfer Hofrates von 1638 und 1693 verurteilt, die vom Magistrat dekretierten Steuern zu bezahlen. Das Verhältnis der Gemeinde Obermaubach-Schlagstein blieb im wesentlichen ungeändert bis zur französischen Occupation. Bis 1971 bildete sie als besondere Gemeinde einen Teil der Bürgermeisterei Nideggen, natürlicherweise infolge der neuen, die früheren Ständeunterschiede vermischenden Verfassung einen gleichberechtigten resp. selbständigen wie Nideggen selbst.
Das Stadtgericht: Das Nideggener Stadtgericht bestand schon 1287, da in diesem Jahre ein gewisser Rudolphus als Schultheiß zu Nideggen erwähnt wird. Seit 1308 besitzen wir Urkunden von ihm, nach denen es das nämliche Siegel führte, das es auch später behalten hat, ein ovales Siegel mit der Unterschrift: Sigillum scabinorum de Nydeckin, zwischen der es an einem Haken von oben herabhängend ein Wappenschild mit dem Nideggener Löwen trägt. Das Gericht genoß ein weit höheres Ansehen als die umliegenden Bauernschöffenstühle, und es wurde von diesen, da sie eines eigenen Siegels entbehrten, häufig der Stadt Nideggen die Ortschaften Abenden und Berg zum Teil, (der andere Teil zur Herrschaft Thum), dann Blens, Bergstein, Brandenberg, Ginnick, Hau, Kall, Obermaubach, Schlagstein zugewiesen. In Blens, Berg, Bergstein, Ginnick und Obermaubach waren auch eigene, mit einem Schultheiß und Schöffen besetzte Gerichte; allein jene Gerichte waren nicht selbständig, ihre Schultheiße waren zugleich und als solche Mitschöffen von Nideggen, sie mussten bei den Herrengedingen zu Nideggen ebenso wie die Bürgerschaft erscheinen und ihre Weistümer verlesen. In kriminellen Sachen nahm der Nideggener Schultheiß zu jenen Ortschaften, die das sogenannte kleine Amt Nideggen bildeten, eine dem Vogte ähnliche Stellung ein; dagegen bezahlten dieselben die Steuern an den Vogt.
Das Stadtgericht bestand aus einem von der Regierung angesetzten Schultheißen, einem Statthalter des Schultheißen, der in Verhinderungsfällen des ersteren den Vorsitz führte (das Recht besaß), und acht gemeinen Schöffen. Die Gerichtssitzungen wurden auf dem Rathaus, welches deshalb auch Dinghaus genannt wurde, gewöhnlich alle 14 Tage, und zwar dienstags abgehalten. (Ding = germ. Volks-, Gerichts- und Heeresversammlung, Thing). Die Nideggener Bürger waren nach dem Privileg von 1313 von dem Gerichte des Vogtes befreit, und der Schultheiß verwaltete auch die Kriminaljustiz selbständig; der Galgen stand am Wege auf Thum zu (dem sogenannten Galgendriesch).
Die Stadt Nideggen hatte das jus arestandi, d.h. das Recht, wenn ein Fremder in der Stadt einen Vertrag geschlossen hatte, und er oder Güter von ihm auf städtischem Gebiete betroffen wurden, sie in Beschlag zu nehmen und vom Schultheißen als ordentlichem Richter in der Sache entscheiden zu lassen. Da auch Düren dasselbe Recht hatte, bestand zwischen beiden eine alte Übereinkunft, gegen die beiderseitigen Bürger keinen Gebrauch davon zu machen, wie es in einem Bericht des Schultheißen von Nideggen 1500 heißt. Außer der eigentlichen Rechtspflege hatte das Gericht noch andere Amtsbefugnisse; so wirkt es besonders mit bei der Verwaltung des Kirchenvermögens durch den Rat.
Rückblick in die Geschichte der Stadt Nideggen
Erbauer der Burg Nideggen war allem Anschein nach Graf Wilhelm II. von Jülich (+ 1207) in den Jahren 1177-1191.
1191 bestand Nideggen schon. Damals gehörte das "Schloß" mit 24 mansi (Landkomplexe von 20 bis 30 Morgen) dem Erzbischof Philipp von Köln (1168-1191), dem es die Grafen von Jülich um 1.600 Mark verkauft hatten. Die erzbischöflichen Höfe Petternich und Rödingen wurden ihnen dafür verpfändet. (aus Pingsheimer Friede 1279).
1198 war Nideggen vermutlich noch im Besitz der Erzbischöfe von Köln; Wie Nideggen dann wieder in den Besitz der Grafen von Jülich kam, ist nicht völlig klar. Möglich ist, daß die Kaufsumme durch die Erbischöfe von Köln nicht voll aufgebracht werden konnte und daß die Burg an die Grafen zurückfiel, oder daß sich Graf Wilhelm durch Gewalt wieder in ihren Besitz setzte. Jedenfalls entstanden daraus jahrzehntelange Fehden.
1207 starb Graf Wilhelm II. von Jülich in Nideggen. Er hatte im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts Alveradis von Maubach, die Tochter des Grafen Albert von Maubach, geheiratet und erbte 1177 bei dessen Tode die Grafschaft Mol- oder Maubach nebst der Waldgrafschaft des Reichswaldes (Osninch). Der Reichswald dehnte sich zwischen Cornelimünster, Düren und Heimbach (Hengebach) aus und gehörte vordem dem Grafen von Nörvenich. Albert von Molbach, Nörvenich. Nach der Sage waren die Burgen Heimbach, Nideggen und Nörvenich in einer Hand. Graf Wilhelm II. von Jülich wird von Cesarius von Heisterbach als grausam und wollüstig geschildert, vor dem keine Frau und Jungfrau sicher war, der Kirchen verfolgte, ihre Güter an sich riß, die Priester verstümmelte und verjagte. Seine Frau Alveradis sperrte er ein, ließ sie im Sommer mit Honig bestreichen und in einem eisernen Käfig an der Burg aufhängen. Ruhelos wie sein Leben soll auch sein Tod gewesen sein. Er starb kinderlos.
Sein Nachfolger war der Sohn Wilhelm seiner Schwester Jutta und des Grafen Everhard von Hengebach als Graf Wilhelm III. von Jülich. Alveradis heiratete Otto von Wickrode.
1214 Friedrich II. von Hohenstaufen, Gegenkönig von Otto IV., zog 1214 an den Niederrhein, um sich in Aachen krönen zu lassen. Graf Wilhelm III. von Jülich, Walram von Limburg und andere überfielen den Nachtrab. Dessen Führer, Herzog Ludwig von Bayern, wurde gefangen und nach Nideggen auf die Burg gebracht. Da Jülich von Friedrich II. belagert und erstürmt wurde, bat Wilhelm um Frieden, erhielt ihn und mußte Ludwig herausgeben. Danach stand Jülich meist auf seiten der Hohenstaufen, auch als Friedrich II. im Banne war.
1219 schenkte Graf Wilhelm III. von Jülich dem Deutschen Orden den Burgberg zu Bergstein mit den Trümmern. Es ist möglich, daß die Trümmer für den Jenseitsturm der Burg Nideggen geholt wurden. In diesem Jahre wurde auch eine Kommende des Deutschen Ordens an der Pfarrkirche eingerichtet und dem Deutschen Orden auf ewig geschenkt. Sie wurde kurze Zeit später in eine Kommende des Johanniterordens umgewandelt.
1219 starb Graf Wilhelm III. Nachfolger wurde sein Sohn, Graf Wilhelm IV. von Jülich.
1241 Der Erzbischof von Köln, Konrad von Hochstaden, der Erbauer des Kölner Domes, erklärte sich gegen den Kaiser. Graf Wilhelm IV. von Jülich, die Städte Aachen und Köln und die meisten Herren am Niederrhein rüsteten für den Kaiser. In der Schlacht in "Badua" (im Walde Bade bei Nideggen) wurde Konrad schwer verwundet und nach Nideggen gebracht. Nach anfänglicher Weigerung, sich zu vergleichen, wurde er um 4000 Mark und andere Konzessionen durch Vermittlung des Ritters Arnold von Diest nach neunmonatiger Gefangenschaft freigelassen am 2. November 1242.
1242 Neuer Krieg zwischen beiden.
1254 erklärte ein Schiedsspruch die Schlösser Nideggen, Heimbach und Jülich als Eigentum der Kölner Kirche. Graf Wilhelm IV. sei nur Burggraf in Jülich und mit Nideggen belehnt. Der Graf fügte sich nicht, verwüstete die Güter der Geistlichen und vertrieb sie.
1255 Ein Breve des Papstes, Alexander IV. bestätigte den Schiedsspruch von 1254.
1261 starb Erzbischof Konrad von Hochstaden. Danach begannen noch heftige Fehden mit seinem Nachfolger, Erzbischof Engelbert II. von Falkenburg.
1267 fiel der Erzbischof Engelbert II. plötzlich in die Jülichen Lande ein, nahm Sinzig und andere Orte durch Überrumpelung.
1267 18. Oktober, Schlacht am Marienholz zwischen Zülpich und Lechenich, Erzbischof Engelbert II. und Graf Diedrich von Cleve wurden gefangen und nach Nideggen gebracht. Dietrich erhielt bald die Freiheit, da er seine Tochter dem Sohne Wilhelms, Gerard, zur Frau versprach. Engelbert mußte bleiben, wurde in Ketten gelegt und im Verlies neben der Burgkapelle gefangengehalten. Der päpstliche Nuntius Bernhard von Castineto schickte den Chorbischof Winrich, den Dechanten von St. Georg, den Guardian der Minoriten und den Dominikaner-Povinzial Albertus magnus als Unterhändler. Umsonst. Auch die Drohungen des Papstes fruchteten nichts.
(In dem Gitter in der Pfarrkirche soll auch Erzbischof Engelbert gesessen haben, sooft und solange der Graf es wollte.)
1268 Graf Wilhelm IV. wird gebannt. Engelbert wurde aber erst am 10. August 1270 nach dreieinhalbjähriger Gefangenschaft freigelassen und mußte für seine entsetzliche Unterkunft und Verpflegung noch 100 Mark, weitere 300 Mark als Sühne bezahlen und viele Gerechtsame an die Grafen von Jülich, Cleve und Berg abtreten. (Sage vom Schluffjahn, als der Graf Wilhelm IV. wegen seiner Grausamkeit gegen den Erzbischof umgehen muß.) 1277 griff Wilhelm IV. mit seinem Sohne Gerard und zwei weiteren natürlichen Söhnen am 16. März, abends 9 Uhr, Aachen an mit 472 Rittern und Knechten. Er und seine Söhne wurden von einem Grobschmied erschlagen. Seine und seiner Söhne Leichen wurden in der Pfarrkirche Nideggen beigesetzt. Seine Frau Richardis begab sich unter den Schutz Hermanns von Mulenarken, Heinrichs von Sponheim und Heinrichs von Virneburg. Sofort fiel der Erzbischof von Köln, Siegfried von Westerburg, ins Jülicher Land ein, nahm Jülich, Düren, Zülpich, alle Städte und Schlösser, nur Nideggen nicht.
1278 14. Oktober: Friede von Pingsheim. Nideggen wird als Eigentum der Kölner Kirche bezeichnet, das die Grafen von Jülich zu lehen hätten. Auch Siegfried von Westerburg soll in Nideggen gefangen gewesen sein.
1279 20. September: Friede von Schönau mit Aachen. Für die Erschlagenen wurden auf Kosten der Aachener vier Altäre errichtet, zwei davon in der Pfarrkirche zu Nideggen. Das Recht der Besetzung schenkten Frau Richardis und ihr Sohn, Graf Walram von Jülich, 1282 dem Johanniterorden. Auch Frau Richardis liegt in Nideggen in der Kirche begraben.
1290 Graf Walram von Jülich heiratete eine Nichte des Erzbischofs Siegfried von Westerburg. Damit hatten die Köln-Jülicher Fehden ein Ende.
1308 Nideggen erhält eigenes Stadtgericht mit Schultheiß, Schöffen und Gerichtssiegel.
Urkunde vom 25. 12. 1313 Stadtprivileg Nideggen
Übersetzung der Urkunde von Nideggen vom 25.12.1313 von Prof. Dr. Lennarz:
Im Namen des Herrn. Amen. Wir, Gerhard, Graf von Jülich, Elisabeth, Gräfin von Jülich, und Wilhelm, der Erstgeborene derselben, wünschen allen, die das gegenwärtige Schriftstück sehen und hören, mit der Kenntnis der Wahrheit alles Unterschriebenen Heil und alles Gute. So stark sind die Wünsche unseres Herzens bezüglich der Förderung und Begünstigung derjenigen, die sich zur Bewohnung unserer Stadt Nydeckin begeben haben, zu der wir vor unsern übrigen Städten eine besondere Gunst hegen, daß wir öfters darüber nachgedacht haben, wie für die Bewohner und die in Zukunft darin Wohnenden durch ein einzigartiges Befreiungsvorrecht scharfsinnig und mit glühender Seele gesorgt werden könnte. Eben deshalb wünschen wir, daß es zur Kenntnis der Gegenwärtigen wie der Künftigen gelange, daß wir alle und jegliche, Geistliche, Ritter, Laien und Frauen, von welchem Stande und Rechtsverhältnis, von welcher Hoheit und Würde sie auch immer seien, auch gleich, ob sie einheimisch sind oder anderswoher kommen, die sich zu unserer vorerwähnten Stadt zum Bleiben gewandt und ihren Wohnsitz darin genommen haben, durch das Schutzmittel dieses gegenwärtigen Schriftstücks mit den Personen, Gütern, Familien und allen ihren beweglichen und unbeweglichen Gütern innerhalb des Landes und Gebietes unserer Herrschaften und der unserer Nachfolger und innerhalb der gesamten Grenzen aller vorerwähnten Herrschaften befreien, sichern und ausnehmen, und wir wollten für uns und unsere Nachfolger und beschließen durch ein ständiges Gebot in diesem Schriftstück, daß sie nach ständigem Recht frei und befreit sind von allen Erhebungen, Beden, Steuern, Bittsteuern, Akzisen und allen irgendwie benannten anderen Verpflichtungen. Wir wollen auch, daß, wenn jemand die Bewohner in der besagten Stadt oder deren Güter vor Gericht zieht, sie sich nirgendwo anders verantwortlich, sondern nur vor dem zeitigen Richter in Nydeckin. Damit diese von uns freigibig und nach reiflicher Überlegung verliehene Freiheit in allen folgenden Zeiten unerschüttert bleibe, haben wir dieses Schriftstück hierüber anfertigen lassen und bekräftigen das gegenwärtige Zeugnis durch die Beifügung unserer Siegel. Gegeben in Nydeckin im Jahre des Herrn 1313 am Geburtstage des Herrn Jesu Christi.
Weitere Urkunden Stadtprivileg Nideggen
8. September 1331 25. September 1511
4. Februar 1367 5. August 1609
7. Januar 1413 4. Juli 1661
8. Januar 1435 31. März 1681
16. September 1437 18. Februar 1703
21. Juli 1486 25. Mai 1703
1313 Nideggen erhält städtisches Privileg durch Graf Gerhard von Jülich. Befreiung von allen Lasten, Beden, Zöllen, Accisen und Steuern. Vor dem Brandenberger Tor wird ein Kollegiatstift errichtet mit 26 geistlichen Stellen mit Kloster und Kirche. Zusicherung an die Stadt Nideggen eigener Gerichtsbarkeit auf ewig.
1314 Ritter Reinhold von Falkenburg Gefangener auf Burg Nideggen. Herzog Wilhelm I. von Jülich war der bedeutendste Herzog von Jülich. Unter ihm wuchs Jülich an Ehren und Macht.
1327-1330 begleitete er Kaiser Ludwig den Bayern nach Italien und stand ihm gegen den Ungarnkönig bei.
1335 verpfändete ihm der Kaiser die innerhalb der Bannmeile von Aachen gelegenen Dörfer und den Gutszubehör und schenkte ihm kurz nach 1336 den Reichswald zwischen Cornelimünster und Montjoie.
1336 wurde er zum Markgrafen erhoben und in die vier erblichen Hofämter des Truchseß, Schenken, Marschalls und Kämmerers eingesetzt.
1338 wurde er Reichsmarschall.
1340 wurde er Pair von England und Graf von Cambridge mit einer Jahresrente.
1347 erhielt er das Schulzenamt der Stadt Aachen und die dortige Propsteistelle. Verpfändung der Städte Düren, Sinzig, Remagen, Burg Kaiserswerth und der Propsteien zu Kerpen und Werden. Von diesen Einkünften erweiterte er die Burgen Sinzig und Nideggen. Nideggen erhielt den Rittersaal, der im damaligen Deutschland der drittgrößte Saal war.
1356 wurde er Herzog auf dem Fürstentag zu Metz. Feier und Turnier auf der Burg Nideggen. Im gleichen Jahre kaufte er noch Montjoie und Falkenburg.
1361-1365 folgt ihm Herzog Wilhelm II. Große Unsicherheit im Lande trotz abgeschlossenen fünfjährigen Landfriedens. Herzog Wilhelm II. gestattete Wegelagern gegen Anteil an der Beute Schutz in seinem Lande.
1371 Schlacht bei Baesweiler: Herzog Wenzel, der Bruder des Kaisers Karl IV. drang mit einem mächtigen Heer am 21. Und 22. August in Jülich ein. Anfangs wandte sich das Jülicher Heer zur Flucht. Zur entscheidenden Stunde erschien Eduard von Geldern und warf den Feind zurück. Die Jülicher errangen einen großen Sieg. 8000 Feinde blieben auf der Walstatt. 270 Grafen und Ritter wurden gefangen und verurteilt. Herzog Wenzel fiel Herzog Wilhelm II. zu. Dieser behandelte ihn mit feiner Höflichkeit und führte ihn selbst in Begleitung zweier ebenfalls gefangener Edelleute, der Herren von Seron und Peter von Baer, zunächst nach Jülich und dann nach Nideggen. Der Kaiser sprach die Reichsacht aus und erschien mit Bischöfen, Fürsten, Edlen und 1100 Rittern.
1372 im Juni zu Aachen. Jetzt gab Herzog Wihelm II. nach, gab Herzog Wenzel heraus und unterwarf sich der Gnade des Kaisers, der ihm verzieh und seine beiden Söhne mit der Grafschaft Zütphen und dem Herzogtum Geldern belehnte.
1387 Krieg zwischen Herzog Wilhelm von Geldern und der Herzogin von Brabant. Die Brabanter wurden in einer Schlacht an der Maas besiegt. Die Brabanter riefen den Herzog von Burgund zu Hilfe. Herzog Wilhelm II. von Jülich griff ein und rief England um Beistand an, das schon ein halbes Jahrhundert mit Frankreich im Krieg lag. Er sagte dem König Karl von Frankreich selbst Fehde an. Dieser wiederum sagte dem Herzog von Jülich selbst Fehde an und zog mit 200 000 Mann ins Herzogtum Jülich und lag vor Nideggen am 17. November 1387 zu Wollersheim drei Tage lang. Dann vertrug er sich mit ihm und zog nach Geldern, schloß jedoch auch hier nach drei Wochen einen günstigen Frieden. Vermittler waren der Erzbischof von Köln, der Bischof von Lüttich und der Herzog von Lothringen, der nach Nideggen ging. Auch Herzog Wilhelm von Geldern kam nach Nideggen, wo im Zelte des Königs der Friede geschlossen wurde.
1412 ist Nideggen mit Zülpich dem Ritter Engelbert Nit von Birgel verpfändet als Burggraf, Amtmann und Vogt zu Nideggen und Zülpich unter Herzog Reinard von Jülich und Geldern.
1419 bezog Ritter Nit von Birgel die Renten von Nideggen, Hengebach und anderen Orten.
1423 stirbt mit Herzog Reinold III. dem zweiten Sohne Herzog Wilhelm II., das Jülich-Geldrische Haus aus. Es erben ein Viertel Johann II. von Loen, Herr zu Heinsberg, Lovensberg usw., drei Viertel Herzog Adolf II. von Berg und regieren das unteilbare Land zusammen.
1429 Den am 16. April geschlossenen Burg-, Städte- und Landfrieden unterzeichneten und besiegelten Bürgermeister, Schöffen und Räthe der Stadt Nideggen. Die Städte von Geldern wählen Arnold von Egmont zum Herzog. Kaiser Sigismund belehnte zwar Herzog Adolf II. von Berg mit Geldern und ächtete Arnold von Egmont. Letzterer blieb aber im Besitz von Geldern.
1425 13. August: Johann III. von Loen heiratet Johanna von Diest. Nideggen ist unter dem Heiratsgut.
1433 Herzog Adolf von Jülich-Berg verlieh seinem Erbmarschall Frambach von Birgel das Recht, das Amt Nideggen an sich zu lösen als Pfand, das zu dieser Tys von Heisteren innehatte. Später waren Nideggen, Zülpich und Montjoie dem reichen Ritter Wilhelm von Vlatten verpfändet. Die Herzöge aus dem Hause Berg hielten sich noch oft in Nideggen auf. Viele Urkunden sind zu Nideggen gegeben. Besonders Herzog Gerhard I. (1437-1475) hatte eine große Vorliebe für Nideggen. Er stiftete den St. Hubertus-Orden mit dem Sitz in Nideggen zum Andenken an den Sieg über Arnold von Egmont, den er
1444 am 4. November bei Linnich schlug, weil er wiederholt ins Jülicher Land eingefallen war.
1470 wurde der bei der Belagerung des Schlosses Tomberg gefallene jugendliche Sohn Gerhards I., Adolf, in der Kirche zu Nideggen beigesetzt. Ebenso seine Mutter Sophia sowie Wilhelm von Loen, Herr zu Jülich. Bürgermeister, Schöffen und Rat der Stadt Nideggen wurden im 15. Jahrhundert zu allen Staatsverträgen hinzugezogen. Sie hatten das Recht, auf dem Landtag zu erscheinen, noch 1623, obwohl sie es nie ausübten.
1475 Nach Herzog Gerhard I. Tode wurde Nideggen über den neuen Residenzen Düsseldorf und Cleve vergessen. Im 16. Jahrhundert diente das Schloß nur noch dem Amtmann Werner von Binsfeld als Wohnung. Bild Burg Nideggen zu Ende des 14. Jahrhunderts
1538 Vertrag zwischen Herzog Wilhelm von Cleve, Jülich und Berg und den geldrischen Landständen über die Nachfolge im Geldernschen. Kaiser Karl V. wollte Geldern als erledigtes Reichslehen einziehen. Darüber kam es zur Jülichschen Fehde.
1542 Der geldernsche Marschall Martin von Rossum dringt mit Unterstützung des Herzogs Wilhelm in das kaiserliche Erbland Brabant ein. General Prinz Renatus von Oranien-Nassau, kaiserlicher Feldherr, dringt am 3. Oktober in die jülichschen Lande ein. Düren ergibt sich am 8., Jülich am 12. Oktober. Auch Nideggen fiel im Kampfe und wurde durch Brand zerstört. Verwüstung des Schlosses und der Stadt muß entsetzlich gewesen sein. Die Befestigungen wurden sehr übel zugerichtet. Schloß und Stadt wurden nur notdürftig wieder aufgebaut. Das Kollegiatstift zog nach Jülich. Viele Adelige und Beamte zogen fort, die Handwerker wanderten ab. Die Johanniter verließen ihr Kloster an der Pfarrkirche und setzten nur einen Pfarrer ein.
1569 Umzug des Stiftskapitels nach Jülich.
1573 Nideggen erhielt das Privilegium dreier Jahrmärkte, da die Bürger zu verarmen drohten. Aber ihre freie Verfassung blieb und alle Vorrechte, die die der übrigen Städte des Herzogstums übertrafen. Sie zahlten keine Steuern, hatten unentgeltlich Brand- und Bauholz und freie Viehweiden.
1602 Nideggen kommt als Heiratsgut an Herzogin Antonette von Lothringen durch Herzog Wilhelm.
1606 25. September: Besuch der Herzogin.
1609 25. März: Herzog Johann Wilhelm stirbt. Es beginnt der Jülichsche Erbfolgestreit. Sieben Fürsten beanspruchen das reiche Jülicher Erbe, darunter der Pfalzgraf von Neuburg und der Kurfürst von Brandenburg.
1609 20. April: Der pfälzische Gesandte Schönenstein mit Notar Tilmann aus Mausbach und zwei Zeugen wollen von Nideggen Besitz ergreifen. Sie halten vor dem Schlagbaum am Dürener Tor. Der Rat der Stadt verweigert den Eintritt, da Nideggen Wittum sei.
28. April: Die Brandenburgischen erscheinen ebenfalls erfolglos. 6. Juli und 5. August: Der Rat der Stadt Nideggen huldigt beiden.
1610 starb Herzogin Antonette von Lothringen. (1666 fiel Nideggen endlich an den Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg)
Im Dreißigjährigen Kriege stieg das Elend der Stadt Nideggen bis zur unerträglichen Höhe. Fortwährende Einquartierungen, Kontributionen, Brandschatzungen und Plünderungen ließen die Bürger völlig verarmen. Die meisten der Einwohner "Verfielen". Nacheinander lagen Kaiserliche, Spanier, Deutsche, Lothringer, Italiener und andere Kriegsvölker, einmal auch pikkolominische, als befreundete Besatzung in Stadt und Burg. Sie stahlen, raubten, plünderten und brandschatzten alle; zum mindesten forderten sie stets mehr, als ihnen zustand. Sie lagen alle dort zur Qual der Einwohner, zerschlugen Fenster, Geschirr und Gerät und zum Schluß die Einwohner selbst. Wenn sie ja einmal wechselten oder ins Feld zogen, ließen sie Weiber und Kinder da. Es heißt in einem zeitgenössischen Bericht: "Diß durch solche schweren guarnison verdorbenes und ausgebranntes Stättlein, darinnen sich nunmehr gar wenig Bürger mehr aufhalten können, sondern teglichs jhe lenger, jhe mehr verlauffen." Viele Bürger starben durch Krankheiten, die die Soldaten eingeschleppt hatten.
1614 begannen die Besatzungen schon und wechselten ständig bis 1642. Da überrumpelten die Hessen unter Graf von Guebriant und Oberst Eberstein Nideggen und verwüsteten es. Die Besatzung der Burg soll durch den sagenhaften unterirdischen Gang nach Montjoie entkommen sein.
1646 besetzte der kaiserliche General Melander Nideggen wieder.
1647 nahmen die Hessen erneut Nideggen. Sie sprengten den Turm der Pfarrkirche und stellten ihre Pferde in die Kirche. Am 7. Dezember ließ der kaiserliche General Lamboi Nideggen erneut stürmen.
1648 war der kaiserliche Hauptmann Dury Roste Kommandant des Schlosses.
1650 mußte Nideggen trotz des Friedens noch einen hessischen Offizier mit 24 Mann aufnehmen, der Satisfaktionsgelder eintreiben sollte.
1673 Mit Beginn der Kriege Ludwig XIV. von Frankreich begann eine neue Leidenszeit Nideggens. Bis 1678 wechselten die kaiserlichen Garnisonen ständig mit den alten Plackereien.
1678 nahmen die Franzosen das Schloß ein und zerstörten es fast ganz. Auch sie legten mancherlei wechselnde Einquartierung in die Stadt.
1679 Nach dem Frieden zu Nimwegen lagen kurfürstliche Truppen in Nideggen.
1701 begann der spanische Erbfolgekrieg.
1702 9. September: Eine als Bauern und Studenten verkleidete "La Croixsche" Truppe erschoß den Wächter im Zülpicher Tor und besetzte die Stadt. 1704 12. Januar: Zwischen 10 und 12 Uhr abends stiegen 160 französische Soldaten unter Hauptmann de Landres über die Mauern der Stadt, steckten sie an drei Stellen in Brand und plünderten sie.
1705 Englische und holländische Truppen in Nideggen.
1706 zogen wieder Franzosen durch Nideggen. Danach wieder pfälzische Einquartierung.
1740 Östereichischer Erbfolgekrieg bis 1748.
1741 lagen französische Truppen in der Stadt.
1743 marschierte die englische, mit Österreich verbündete "pragmatische" Armee durch.
1748 Franzosen und kaiserliche Truppen, u.a. ungarische Husaren in Nideggen.
1755 und 1756 beschädigte ein Erdbeben die Burgreste, die noch als Wohnung für den Kellner und als Früchtespeicher gedient hatten.
1758 tauchten preußische Truppen auf. Danach wieder Franzosen.
1765 27. Januar, wütete ein Großfeuer in der Stadt.
1770 heißt es: der Ort hat ein trauriges Aussehen. Es wird kein Handel und Gewerbe darin betrieben.
1784 Durchzug der österreichischen Armee unter Kaiser Josef II. nach Holland.
1794 Im französisch-Österreichischen Krieg entbrannten Kämpfe die Rur entlang von Maubach bis Linnich. Die Franzosen überschritten die Rur und besetzten Nideggen. Das Amt Nideggen wurde Kanton oder Munizipalbezirk, später Mairie im Arrondissement Aachen. Der Amtskellner wurde aus der Burg gejagt, die Burg zunächst verpachtet, dann für ein Spottgeld auf Abbruch verkauft. Der Käufer, Apellationsgerichtsrat Evertz, brach das Dach vom Jenseitsturm und die Früchtespeicher ab. Treppenstufen und Haussteine wurden karrenweise verkauft und zum Bau der Häuser in Nideggen und Umgebung verwandt.
1815 Nideggen kommt mit dem Großherzogtum Niederrhein an König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Es beginnt eine lange Friedenszeit, in der sich die Stadt erholt, ohne sich über den Rahmen eines kleinen Ackerbürger- und Handwerkerstädtchens zu erheben.
1878 Durch erneute Erdbeben fielen weitere Teile der Burg ein.
1896 stürzte ein großes Stück des Jenseitsturmes ein.
1898 Auf betreiben des Fabrikanten Erich Schleicher, Düren und unter Mitwirkung des Königlichen Kammerherrn und Landrates von Breuning zu Haus Boisdorf werden die Tore der Stadt Nideggen in alter Pracht wieder aufgebaut. Schleicher regte auch zum Wiederaufbau der Burg an. Mit Hilfe des Geheimen Kommerzienrates Schoeller, Düren, wurde die in einzelnen Parzellen verkaufte und vererbte Burg zurückgekauft und dem Kreis Düren zum Geschenk gemacht.
1902 Die Burg wird instandgesetzt. Der Brunnen wurde bis zu einer Tiefe von 96 Metern bei einem Wasserstand von zwei Metern wieder ausgeschachtet. Nach dem damaligen Befund dürfte er nie über 100 Meter tief gewesen sein.
1903 Kaiser Wilhelm II. gibt 15.000,- Mark zum Wiederaufbau der Burg.
1904 Der Bergfried (Jenseitsturm) wird wieder aufgebaut. Nideggen ist zum beliebten und bekannten Luftkurort geworden.
1926 13. Februar: durch Erlaß des Staatsministeriums erneute Stadtrechtverleihung. In der französischen Besetzung 1794 gingen die Stadtrechte verloren.
1926 26. Juli: Feier auf der Burg Nideggen aus Anlaß der Wiedererlangung des Rechtes von Nideggen, die Bezeichnung "Stadt" zu führen. Durch die Deutsche Gemeindeordnung vom 30.1.1935 erhielt Nideggen vollrechtlich und uneingeschränkt den Titel "Stadt".
Die Kellnerei zu Nideggen
Auf dem Schloß zu Nideggen wohnte früher ähnlich, wie auf anderen jülichen Schlössern, ein Burggraf, dem außer der Bewachung desselben wahrscheinlich auch die Einziehung der Gefälle (Steueraufkommen) und Renten, wie die Verwaltung der Domänen und sonstige finanzielle Geschäfte oblagen. Während jedoch anderswo, z.B. in Heimbach, das Amt eines Burggrafen sich erhielt, ist es in Nideggen schon im Anfange des 16. Jahrhunderts verschwunden; an seine Stelle ist ein sogenannter Kellner getreten, dem die finanzielle Seite des Amtes allein übrig blieb; 1534 den 16. August verpfändete der Herzog die Kellnerei an Wirich von Gertzen für 2000 Gulden; der Pfandbrief wurde 1708 von den Gebrüdern von Gimnich eingelöst.
Der Kellner wohnte auf der Burg, in welcher der Jenseitsturm und einige Gebäude so weit hergestellt waren, daß sie als Fruchtspeicher, Kelterhäuser und Weinkeller benutzt werden konnten. Derselbe hatte 1698 als Bestallung 40 Malter Hafer, 24 Malter Korn, eines Burggrafen freie Wohnung, den Garten am Schloß, anderthalb Morgen Ackerland, 11 Gulden an Holzgeld; die Windschläge in den fürstlichen Büschen und freies Brandholz, sowie 28 Goldgulden 88 Albus.
Über die Verwaltung der Kellnerei gibt uns eine Rechnung von 1715/16 nähere Aufschlüsse. Die Berechnung der eingegangenen und ausgegebenen Gelder geschah damals nach dem Provisional-Münzedikt von 1632. Danach wurde ein Goldgulden zu 4 oberländischen Gulden 16 Albus empfangen, zu 4 1/2 Kopfgulden ausgezahlt,
1 Radergulden = 24 Rader-Albus,
1 oberländischer Gulden = 24 Albus,
1 Rader-Albus = 12 Raderheller,
1 Albus = 12 Heller.
Die Flüssigkeiten wurden mit Kölner und oberländischem Maß gemessen und damit nach Düsseldorf geliefert und berechnet.
1 Fuder Cöln. = 6 Ohm,
1 Ohm = 26 Viertel
1 Viertel = 4 Quart.
Die Früchte wurden mit Nideggener Burgmaß gemessen, das dem Zülpicher Maß gleich war, nämlich:
1 Malter = 5 Sümber
1 Sümber = 4 Viertel
1 Viertel = 4 Mütgen
20 Malter Nideggen = 21 Malter Hofmaß, das dem kölner Maß gleich war.
1 Dürener Malter = 1 Malter 2 Viertel 1 1/2 Mütgen Burgmaß nach Resolution der Regierung von 1695. Der Schatz, d.h. die Landessteuer, wurde nach den Hebezetteln von 1553 durch die Honnen erhoben und aufs Schloß geliefert. Er wurde in 2 Terminen, als Herbst- und als Maischatz fällig. Außerdem empfing der Kellner die Pacht von den kurfürstlichen Benden, die Mühlenpacht, das Beedgeld, Dienstgeld, den Zehnten, Churmuth und andere Gefälle, zu deren Eintreibung er einen besonderen Exekutionsboten hatte. Die Naturalabgaben (Roggen, Weizen, Gerste, Erbsen, Wein, Holz usw.) wurden aufs Schloß geliefert und dort von einem Früchtemesser, der auch die Stelle eines Pförtners versah, gemessen, hierauf teils an Händler verkauft, das übrige nach Hambach oder Düsseldorf abgeliefert.
Das zur Fortschaffung nötige Fuhrwerk hatten die Dörfer des Amtes teils unentgeltlich teils gegen Bezahlung, zu stellen. Auch sonstige zahlreiche Fronfuhren hatten die Bauern zu leisten, meist im Spätherbst, woher das Sprichwort entstand: "Ist martin vorbei, so ist der Bauer keinen Tag mehr frei". Die Dörfer Abenden, Berg bei Nideggen, Bergheim Bergstein, Brandenberg, Blens, Bogheim, Ginnick, Hau, Kreuzau, Thuir, Winden mußten Brandholz aus den fürstlichen Wäldern und alle Notdurft (Nahrung) auf das Schloß fahren; sie kauften sich mit Beistimmung des Amtmannes Werner von Binsfeld gegen 75 Gulden davon los, die sie unter sich verteilten und mit dem Schatz (Abgaben) bezahlten; auf Verlangen sollten sie jedoch die alten Fuhren leisten, dann aber von den 75 Gulden frei sein.
Die Leute von Hausen hatten 1.600 Rahmen (Weinbergpfähle) in die fürstlichen Weingärten zu Bürvenich zu liefern, die sie im Heimbacherwald für 4 Gulden hauen und für 12 Gulden fahren mußten, von 1715 an laut kurfürstlichen Befehls unentgeltlich. Waren viele Rahmen nötig, so mußte die doppelte Anzahl von Fuhren geleistet werden. Auch Hergarten, Vlatten, Bürvenich, Floidorf u.a. hatten aus den Heimbacher Büschen in die Weingärten Rahmen zu fahren. Diese Fronarbeiten wurden später in Geld umgewandelt. Diejenigen, welche zu Berg bei Floisdorf Pferde besaßen, mußten wegen etlicher vom Kurfürsten ihnen überlassenen Weideplätze dessen Trauben aus den Weingärten an den Kelter fahren und den Dünger aus dessen Hof zu Bürvenich in die Weingärten und Heu nach Nideggen und Heimbach. Verschiedene Höfe und Klöster mußten in Kriegszeiten Heerwagen stellen.
Auch auswärtige Dörfer waren mit Fronfuhren für die Kellnerei beschwert. So mußte das Lehngut Dommermut im Gericht Lendersdorf, das außerdem mit einem Sattelpferd dienstpflichtig war, für den Herzog Wein im Amt Nideggen aufladen und nach Hambach oder Düsseldorf bringen, wie auch Fässer, Reifen, Rommeln und Fische fahren; ebenso die Gemeinde Arnoldsweiler.
Andere große Lasten für die Bauern waren die Zehnten und der Churmuth. Von ersteren gehörten dem Fürsten die Zehntlämmer zu Bürvenich, die Zehnten zu Schwerfen und Kelz, die halben Zehnten zu Pissenheim (Muldenau), Thum, Berg bei Nideggen, Nideggen, Vlatten, sowie der Rottzehnt von allem urbar gemachten Lande; dieselben waren an den meisten Orten erblich verpachtet. Der Kurmut wurde an anderer Stelle bereits beschrieben.
Dazu kamen die zahlreichen aus den fürstlichen Ländereien, Höfen und Mühlen usw. gewonnenen Erbpächte an Geld, Hafer, Roggen, Spelz, Hühnern, Eiern, Kapaunen (Masthähne) usw., wie auch die Einkünfte aus den Weinbergen und Wäldern. Der Fürst hatte das Mühlenregal, d.h. das ausschließliche Recht, Mühlen im Lande anzulegen, resp. gegen eine jährliche Abgabe die Konzession dazu zu erteilen, dem jedoch die Ritterschaft nach altem Landrecht nicht unterworfen war (siehe die Mühle zu Obermaubach - sie gehörte zur Burg und damit den Rittern zu Vlatten).
Die Müller hatten die Mühlen in Erbpacht gegen Geld- oder Naturalabgaben. Sie waren teilweise Zwangsmühlen, d.h. die Bewohner eines bestimmten Distriktes mußten in ihnen mahlen lassen, wodurch ihr Wert sich bedeutend erhöhte. (Die Mühle in Obermaubach .....)
So ließ der Pfalzgraf 1627 in der Pfarrkirche zu Nideggen nach der Predigt verkündigen, daß die Mühle zu Schüdderfeld für die Stadt Zwangsmühle sei und die anderen Müller bei Verlust des Getreides, Esels, Pferdes und Karrens in Nideggen keine Kundschaft suchen sollten. Bürgermeister und Rat protestierten aber gegen diesen Eingriff in ihre Privilegien, da sie seit undenklichen Zeiten auf in- und auswärtigen Mühlen nach Belieben hätten mahlen lassen, und drohten sich ans kaiserliche Kammergericht zu Speyer zu wenden, worauf die Verordnung zurückgenommen wurde.
Um 1700 gab es vier Mühlen bei Nideggen: Die Fruchtmühle zu Schüdderfeld, die Trohnmühle am dicken Stein unter dem Schloß, deren Platz der Herzog 1553 an Peter Trohn in Erbpacht gab, um eine Ölmühle und zur Notdurft ein Rad für eine Kornmühle zu errichten, vorausgesetzt, daß er den übrigen Mühlen nicht schade; dann unterhalb der letzteren die Lohmühle und die Follmühle an der Brücke.
An Weinbergen besaß der Kurfürst 1716 in Winden 7 Morgen 1 Viertel, in Ginnick 19 Morgen 1 Viertel 2 Pinten, in Schwerfen 3 Morgen 3 Pinten. Dieselben wurden auf 12 Jahre in Gegenwart des Kellners, Oberweingartenaufsehers des Amtes und des Unterweingärtners jeden Ortes verpachtet, so daß der Kurfürst die Hälfte der Trauben erhielt, die Pächter den Dünger, die Rahmen und die Arbeit lieferten.
Die Fischerei in Rur und Kall, die sich von Hetzingen bis zum Dorf Zerkall und von da die Kall hinauf bis zum Amt Monschau erstreckte, in der kleinen und großen Uxmaar zu Froitzheim und Thum und im roten Bach wurde vom Kellner verpachtet. (In der Kall, von deren Mündung bis einem Musketenschuß oberhalb der Ölmühle hatte die Stadt Nideggen die Berechtigung, an 2 Wochentagen, Gudestags und Freitags, zu fischen. Als der Kellner selber verpachten wollte, mußte er auf den Protest der Stadt erklären, deren Recht respektieren zu wollen.)
Die Bierakzise (Verbrauchssteuer) des Amtes war 13 Jahre verpachtet dergestalt, daß die Pächter von je 100 Reichstalern Pachtgeld 10 Reichstaler als trockenen Weinkauf im ersten Jahr zahlten. Sie war für die einzelnen Ortschaften verpachtet und brachte 1715 156 Reichstaler auf.
Die Branntweinakzise war fürs ganze Amt für 78 Reichstaler und 10 % trockenen Weinkauf verpachtet.
Dazu kamen die Einkünfte von den Beschneidungen, Heiraten und Todesfällen der Juden (nach dem am 1. Mai 1705 auf 16 Geleitsjahre für 150 Familien in Jülich und Berg ausgestellten Duldungspatent, jedesmal 1 Gulden), von Konzessionen der Pferde- und Gilßenschneider, Kupferschläger u.a.
Der Kellner hatte aus den Einkünften alle Ausgaben des Amtes vorab zu bestreiten, die in Geld und Naturalien bestehenden Gehälter der Beamten und die Stiftungen auszuzahlen, die Reparaturen am Schloß zu besorgen usw. Der Rest wurde nach Hambach oder Düsseldorf abgeliefert.
Die Einnahmen der Nebenzollämter zu Nideggen, Blens, Abenden, Hausen, Heimbach, die zu dem Hauptzollamt von Birkesdorf gehörten und verpachtet waren, wurden nicht bei der Kellnerei, sondern direkt bei der Landrentmeisterei zu Düsseldorf berechnet. Von den meisten dieser Abgaben, Steuern, Frondienst usw. waren die privilegierten Obermaubacher als Bürger der Stadt Nideggen befreit. (Privileg von 1313)
Begebenheit an den Zehnttagen im 15. Jahrhundert
Im sechsten und siebten Jahrhundert wurden die Zehntabgaben allgemein eingeführt. Zehntabgaben bedeutete die Abgabe eines Teiles des Ertrages einer Sache, in der Regel der zehnte Teil der Ernte. Der Zehnt war eine an die Grundnutzung geknüpfte Abgabe.
Der große Zehnt bestand aus allem, "was Halm und Stengel trieb". Daneben bestanden die kleinen Zehntabgaben, die Garten- und Baumfrüchte umfaßten. Der "Garbenzehnt" wurde oft vom Felde weg eingenommen. Der "Blutzehnt" umfaßte die Abgaben des zehnten Teiles an Jungvieh oder Viehproduktion.
Vielerorts finden wir heute noch Bauern- und Gutshöfe, die als Zehnthof bezeichnet werden. Der Name weist in vergangene Zeiten. Auf den Zehnthöfen ging es an festgesetzten Tagen im Jahre recht munter und oft sogar turbulent zu. Ein herausragender Tag war der Martinstag. Ein geschäftiges Treiben herrschte dann auf den Zehnthöfen. Die Lehnsleute mit ihren Frauen und Knechten kamen, um den Zehnten abzuliefern. Auf den Fuhrwerken, die sie mitführten, waren Pacht und Zins in Naturalien geladen.
Nachdem man den Pferden eine Garbe zugestoßen hatte, lud man Weizen, Mehl, Gerste, Stroh und Heu ab. In Gegenwart des Gutsverwalters wurde die Richtigkeit der Lieferung festgestellt. Anschließend mußten die Knechte alle Waren in die Zehntscheuer befördern, die zuletzt wohl bis zum First gefüllt war. Auch geräucherter Speck, Schinken, Hühner, Gänse, Honig, Hanf für die Glockenseile und Wachs für die Kirchenlichter wurden abgegeben und in die Keller und Vorratsräume des Zehnthauses gebracht.
Nach dieser schmerzlichen Pflicht gegann der fröhliche Teil, der ebenfalls an den Zehnttagen vorgeschrieben war. Zunächst bekamen die Knechte zu essen und ein "stoeff wins" zu trinken. Darauf ließ man sie mit den Fuhrwerken nach Hause fahren.
Die Lehnsleute mit ihren Frauen begaben sich in den großen Saal des Zehnthofes. Hier setzten sie sich an die gedeckte Tafel. Die Tische bogen sich unter der Last der Speisen, wie in alten Aufzeichnungen zu lesen ist. Fünferlei Gerichte stand den Lehnsleuten zu. Ein Rind, ein Hammel, ein Schwein, Hühner und Gänse hatten für den Zweck ihr Leben lassen müssen. Ein edler Tropfen Wein durfte beim Mahl nicht fehlen. So wurde das beste Gewächs herbeigeholt, das aufzutreiben war. Jeder durfte nach Belieben essen und trinken. Doch vorher mußte noch das Zeichen zum Beginn gegeben werden.
Ein Wagenrad mit Holz und Stroh gespickt, wurde auf die Feuerstelle geschoben und angezündet. Das war das Zeichen zum Anfang. Das Essen konnte losgehen. Solange das Rad brannte, durften die Lehnsleute mit ihren Frauen bei Tisch sitzen. Da wurde manchmal so hastig hineingelangt, als wenn bei Gewitter das Heu in großen Schauben in die Scheune gestoßen würde.
Aber die damaligen Menschen entbehrten des Humors nicht. Da war ein Tor aufgerichtet, sieben Fuß breit und sieben Fuß hoch. Wehe dem Lehnsmann mit seiner Frau, wenn sie ein zu hitziges Tempo beim Essen eingeschlagen hatten. Nach Beendigung der Mahlzeit mußten sie nämlich gemeinsam durch das Tor schreiten. Dabei durften sie sich nicht an den Türpfosten festhalten oder anstützen, sonst mußten sie eine Strafe zahlen. Wohl manche, die dem Essen und Trinken allzu viel gehuldigt hatten, werden sicher eine Strafe gezahlt haben.
Aus alledem ist ersichtlich, daß die Zehntabgaben nicht als reine Einnahmen gebucht werden konnten. Wie hier dargelegt, ging alleine für Speisen und Getränke, die gestellt werden mussten, ein "erklecklicher" Teil weg, der abgeschrieben werden mußte.